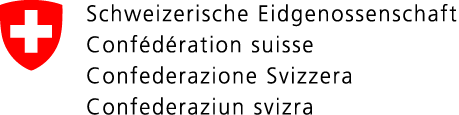(Gesuchseinreichung ab 1.1.2018)
Direkt zu
Siehe auch
Wenn ich 10 Jahre Wohnsitz in der Schweiz habe, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs, und über eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung C) verfüge. Die Zeit zwischen dem vollendeten 8. und 18. Altersjahr wird doppelt gezählt. Bei Doppelzählung hat der tatsächliche Aufenthalt jedoch mindestens 6 Jahre zu betragen (Art. 9 BüG).
Zudem muss ich folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Ich muss in der Schweiz erfolgreich integriert sein, das bedeutet insbesondere:
- Ich kann mich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache verständigen, das heisst meine Sprachkompetenzen sind mündlich mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftlich A2;
- Ich beachte die öffentliche Sicherheit und Ordnung (kein Strafregistereintrag, keine Betreibungen/Verlustscheine, Steuern bezahlt);
- Ich respektiere die Werte der Bundesverfassung;
- Ich nehme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teil (Arbeitsstelle oder Ausbildung, keine Sozialhilfe in den drei Jahren vor der Gesuchseinreichung, ausser ich habe diese vollständig zurückbezahlt);
- Ich fördere und unterstütze die Integration meiner Familienmitglieder.
- Ich bin mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut, das heisst insbesondere:
- Ich habe Grundkenntnisse über die Schweiz in Geografie, Geschichte, Politik und Gesellschaft;
- Ich nehme aktiv am sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft in der Schweiz teil;
- Ich pflege Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern.
- Ich stelle keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz dar.
Die Kantone können weitere Integrationskriterien vorsehen. Für Fragen zu den Einbürgerungsvoraussetzungen im Verfahren der ordentlichen Einbürgerung wende ich mich an die zuständige kommunale oder kantonale Behörde an meinem Wohnort.
Internationale Beamtinnen und Beamte, die im Zeitpunkt ihres Dienstantritts im Besitze eines Ausweises C waren und diesen gegen eine Legitimationskarte des EDA umgetauscht haben, können auch nach dem 1. Januar 2018 ein Gesuch um ordentliche Einbürgerung stellen. Das Gleiche gilt für Familienmitglieder von internationalen Beamtinnen und Beamten, die ihren Ausweis C gegen eine Legitimationskarte des EDA oder gegen einen Ausweis Ci umgetauscht haben.
Das Gesuch um ordentliche Einbürgerung ist je nach kantonaler Regelung beim Kanton oder bei der Gemeinde einzureichen. Auskunft erhalte ich bei der zuständigen kommunalen oder kantonalen Behörde an meinem Wohnort.
Bei der zuständigen kommunalen oder kantonalen Behörde an meinem Wohnort.
Nein. Denn die formellen Voraussetzungen müssen im Zeitpunkt der Gesuchstellung erfüllt sein.
Für die Erteilung der Einbürgerungsbewilligung erhebt das SEM Gebühren im Umfang CHF 100.– für eine erwachsene Person, CHF 150.– für ein Ehepaar resp. eine Familie und CHF 50.– für eine minderjährige Person, die sich selbständig einbürgern lässt. Jeder Kanton und jede Gemeinde erheben zudem im Verfahren der ordentlichen Einbürgerung kantonale und kommunale Gebühren, zu welchen das SEM keine Angaben machen kann.
Auskunft erhalte ich bei der zuständigen kommunalen oder kantonalen Behörde an meinem Wohnort.
Ich brauche eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung C).
Die Jahre mit Ausweis N werden nicht angerechnet; die Jahre mit Ausweis F werden zur Hälfte angerechnet (Art. 33 Abs. 1 lit. b BüG).
Die Jahre mit Ausweis L werden nicht angerechnet.
Die Jahre mit einer Legitimationskaste des EDA oder mit Ausweis Ci werden angerechnet (Art. 33 Abs. 1 lit. c BüG).
Ich muss mich mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten haben, wovon ein Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung und seit drei Jahren mit meiner Partnerin oder meinem Partner in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Zudem muss ich über eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung C) verfügen.
Zudem muss ich folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Ich muss in der Schweiz erfolgreich integriert sein, das bedeutet insbesondere:
- Ich kann mich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache verständigen, das heisst meine Sprachkompetenzen sind mündlich mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftlich A2;
- Ich beachte die öffentliche Sicherheit und Ordnung (kein Strafregistereintrag, keine Betreibungen/Verlustscheine, Steuern bezahlt);
- Ich respektiere die Werte der Bundesverfassung;
- Ich nehme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teil (Arbeitsstelle oder Ausbildung, keine Sozialhilfe in den drei Jahren vor der Gesuchseinreichung, ausser ich habe diese vollständig zurückbezahlt);
- Ich fördere und unterstütze die Integration meiner Familienmitglieder;
- Ich bin mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut, das heisst insbesondere:
- Ich habe Grundkenntnisse über die Schweiz in Geografie, Geschichte, Politik und Gesellschaft;
- Ich nehme aktiv am sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft in der Schweiz teil;
- Ich pflege Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern.
- Ich stelle keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz dar.
Die Kantone können weitere Integrationskriterien vorsehen. Für Fragen zu den Einbürgerungsvoraussetzungen im Verfahren der ordentlichen Einbürgerung wende ich mich an die zuständige kommunale oder kantonale Behörde an meinem Wohnort.
Ich muss in einer schweizerischen Landessprache mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen (Art. 6 BüV). Die Kantone können jedoch höhere Sprachkompetenzen vorsehen. Für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit den erforderlichen Sprachkompetenzen und den hierfür einzureichenden Dokumenten wende ich mich an die zuständige kantonale Behörde.
Kursatteste, die lediglich den Besuch eines Sprachkurses bestätigen sowie online ausgefüllte Einstufungstests genügen nicht.
Wenn ich zum Beispiel wegen einer schwerwiegenden Seh- oder Hörbehinderung, einer schweren oder lang andauernden Krankheit oder einer ausgeprägten Lern-, Lese- oder Schreibschwäche derart beeinträchtigt bin, dass ich auf absehbare Zeit keinen Sprachnachweis vorlegen kann, muss ich eine entsprechende Bestätigung einer medizinischen Fachperson einreichen (Arztbericht, Kursattest, usw.). Die zuständige Behörde entscheidet, wie meinen persönlichen Verhältnissen beim Nachweis der Sprachkompetenzen Rechnung getragen wird.
Erleichterte Einbürgerung
Bei Aufenthalt in der Schweiz:
Als Ehegatte einer Schweizer Bürgerin resp. als Ehegattin eines Schweizer Bürgers kann ich ein Gesuch stellen, wenn ich seit 3 Jahren in ehelicher Gemeinschaft lebe und mich seit insgesamt 5 Jahren in der Schweiz aufgehalten habe, wovon 1 Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuches.
Zudem muss ich folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Ich muss in der Schweiz erfolgreich integriert sein, das bedeutet insbesondere:
- Ich kann mich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache verständigen, das heisst meine Sprachkompetenzen sind mündlich mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftlich A2;
- Ich beachte die öffentliche Sicherheit und Ordnung (kein Strafregistereintrag, keine Betreibungen/Verlustscheine, Steuern bezahlt);
- Ich respektiere die Werte der Bundesverfassung;
- Ich nehme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teil (Arbeitsstelle oder Ausbildung, keine Sozialhilfe in den drei Jahren vor der Gesuchseinreichung, ausser ich habe diese vollständig zurückbezahlt);
- Ich fördere und unterstütze die Integration meiner Familienmitglieder.
- Anlässlich eines persönlichen Gesprächs wird abgeklärt, ob ich Grundkenntnisse über die Schweiz in Geografie, Geschichte, Politik und Gesellschaft habe, aktiv am sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft in der Schweiz teilnehme und Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern pflege.
- Ich stelle keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz dar.
Ich muss in einer schweizerischen Landessprache mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen (Art. 6 BüV).
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn ich
- eine schweizerische Landessprache als Muttersprache spreche und schreibe;
- während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule in einer schweizerischen Landessprache besucht habe;
- eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe in einer schweizerischen Landessprache abgeschlossen habe; oder
- über einen Sprachnachweis verfüge, der die Sprachkompetenzen (mündlich mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftlich mindestens auf dem Referenzniveau A2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen) nachweist und auf der Liste der anerkannten Sprachzertifikate (PDF, 254 kB, 01.01.2026) aufgeführt ist.
Damit ein Test oder Sprachnachweis bzw. Sprachzertifikat im Einbürgerungsverfahren berücksichtigt werden kann, müssen diese auf der Liste der anerkannten Sprachzertifikate (PDF, 254 kB, 01.01.2026) aufgeführt sein.
Kursatteste, die lediglich den Besuch eines Sprachkurses bestätigen, sowie online ausgefüllte Einstufungstests genügen nicht.
Ich muss kein Sprachzertifikat vorlegen, wenn ich:
- eine schweizerische Landessprache als Muttersprache spreche und schreibe;
- während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule in einer schweizerischen Landessprache besucht oder
- eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe in einer schweizerischen Landessprache abgeschlossen habe. In diesem Fall muss ich aber eine Bestätigung einreichen, aus welcher hervorgeht, dass ich während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule in einer schweizerischen Landessprache besucht oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe II (berufliche Grundbildung, gymnasiale Maturität) oder Tertiärstufe (Fachhochschule, universitäre Hochschule) in einer schweizerischen Landessprache erfolgreich abgeschlossen habe. Die obligatorische Schule oder die Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe muss nicht zwingend in der Schweiz besucht worden sein.
Wenn ich zum Beispiel wegen einer schwerwiegenden Seh- oder Hörbehinderung, einer schweren oder lang andauernden Krankheit oder einer ausgeprägten Lern-, Lese- oder Schreibschwäche derart beeinträchtigt bin, dass ich auf absehbare Zeit keinen Sprachnachweis vorlegen kann, muss ich eine entsprechende Bestätigung einer medizinischen Fachperson einreichen (Arztbericht, Kursattest, usw.). Das SEM entscheidet in der Folge, wie meinen persönlichen Verhältnissen beim Nachweis der Sprachkompetenzen Rechnung getragen wird.
Nein. Die Regelung für die eingetragene Partnerschaft sieht vor, dass nur ein Gesuch um ordentliche Einbürgerung eingereicht werden kann. Eine erleichterte Einbürgerung steht nur verheirateten Paaren offen. Weiterführende Informationen finde ich unter FAQ – Ehe für alle (erleichterte Einbürgerung).
Nein, das ist nicht möglich. Hingegen ist eine erleichterte Einbürgerung möglich, wenn der Ehegatte resp. die Ehegattin das Schweizer Bürgerrecht nach der Heirat durch Wiedereinbürgerung oder erleichterte Einbürgerung aufgrund der Abstammung von einem schweizerischen Elternteil erworben hat.
Ja. In der Regel sind aber damit weitere Abklärungen verbunden, welche zu einer Verlängerung des Einbürgerungsverfahrens führen können.
Ja. Der Schweizer Ehegatte resp. die Schweizer Ehegattin muss sich aber bei der Schweizer Vertretung vor Ort melden. In der Regel sind damit weitere Abklärungen verbunden, welche zu einer Verlängerung des Einbürgerungsverfahrens führen können.
Nein. Ich muss im Zeitpunkt der Gesuchstellung seit 5 Jahren in der Schweiz leben und dies mit den entsprechenden Unterlagen dokumentieren (Wohnsitzzeugnisse).
Nein. Mir bleibt lediglich die Möglichkeit, ein Gesuch um ordentliche Einbürgerung zu stellen (siehe Botschaft zu Art. 21 BüG).
An meinem Wohnort oder beim Staatssekretariat für Migration SEM.
Beim Staatssekretariat für Migration SEM.
Die erleichterte Einbürgerung für Ehegatten von Schweizer Bürgern mit Wohnsitz in der Schweiz kostet CHF 900.-. Der gesamte Betrag ist im Voraus zu bezahlen und wird nicht zurückerstattet, wenn das Gesuch abgelehnt wird (Art. 25 BüV). Ratenzahlungen sind nicht möglich.
Bei Aufenthalt im Ausland:
Ich muss seit mindestens sechs Jahren in einer ehelichen Gemeinschaft mit einer Schweizerin oder einem Schweizer leben und eng mit der Schweiz verbunden sein. Zudem erfordert eine erleichterte Einbürgerung, dass ich die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachte, die Werte der Bundesverfassung respektiere, am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teilnehme, die Integration der Familienmitglieder fördere und keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstelle.
Eng mit der Schweiz verbunden ist gemäss Art. 11 BüV, wer:
- sich innert den letzten sechs Jahren vor der Gesuchstellung mindestens dreimal für je mindestens fünf Tage in der Schweiz aufgehalten hat;
- sich im Alltag mündlich in einer Landessprache verständigen kann;
- über Grundkenntnisse der geografischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz verfügt; und
- Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern pflegt.
Nein, das ist nicht möglich. Hingegen ist eine erleichterte Einbürgerung möglich, wenn der Ehegatte resp. die Ehegattin das Schweizer Bürgerrecht nach der Heirat durch Wiedereinbürgerung oder erleichterte Einbürgerung aufgrund der Abstammung von einem schweizerischen Elternteil erworben hat.
Ja. Der Schweizer Ehegatte resp. die Schweizer Ehegattin muss sich aber bei der Schweizer Vertretung vor Ort abmelden, danach bei der Wohnsitzgemeinde in der Schweiz sowie bei der für den/die ausländische/n Ehegatte/in zuständigen kantonalen Migrationsbehörde anmelden. In der Regel ist mit einer Verlängerung des Verfahrens zu rechnen, da zusätzliche Abklärungen notwendig sind.
Bei der zuständigen schweizerischen Vertretung (Botschaft oder Konsulat).
Bei der zuständigen schweizerischen Auslandvertretung (Botschaft oder Konsulat).
Die erleichterte Einbürgerung für Ehegatten von Schweizer Bürgern mit Wohnsitz im Ausland kostet CHF 600.-. Der gesamte Betrag ist bei der zuständigen schweizerischen Vertretung in der entsprechenden Landeswährung im Voraus zu bezahlen. Die Gebühren werden nicht zurückerstattet, wenn das Gesuch abgelehnt wird (Art. 25 BüV). Ratenzahlungen sind nicht möglich. Zudem erhebt die schweizerische Vertretung im Ausland für die erbrachten Dienstleistungen (Beratung, Entgegennahme der Dokumente, Interview, Studium der Akten, Bearbeitung der ausländischen Zivilstandsakten und Weiterleitung des Dossiers an das SEM sowie allfällige weitere Abklärungen und Recherchen) zusätzlich ihre eigenen Gebühren nach ihrem effektiven Zeitaufwand. Im Weiteren können die Zivilstandsbehörden für ihre Tätigkeiten (Überprüfung ausländischer Dokumente im Hinblick auf die Aufnahme der Personenstandsdaten in Infostar) Gebühren separat in Rechnung stellen und via Schweizer Vertretung einkassieren lassen.
Wiedereinbürgerung
Ja. Das im Ausland geborene Kind eines schweizerischen Elternteils, das noch eine andere Staatsangehörigkeit besitzt, verwirkt das Schweizer Bürgerrecht mit der Vollendung des 25. Altersjahres, wenn es bis dahin nicht bei einer Schweizer Behörde im Ausland (Botschaft, Konsulat) bzw. in der Schweiz (Zivilstandsamt) gemeldet wurde, sich nicht selber angemeldet oder seinen Willen zur Beibehaltung der Schweizer Staatsangehörigkeit nicht schriftlich bekundet hat.
Ja, wenn ich das Schweizer Bürgerrecht verloren habe, kann ich bei der zuständigen schweizerischen Vertretung innert zehn Jahren nach dem Verlust ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen. Dazu muss ich eng mit der Schweiz verbunden sein. Ich muss zudem die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachten, die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden, die Werte der Bundesverfassung respektieren, am Wirtschaftsleben teilnehmen oder mich in Aus- oder Weiterbildung befinden und die Integration meiner Familienmitglieder fördern und unterstützen.
Nach Ablauf der Zehnjahresfrist kann ich die Wiedereinbürgerung nur noch beantragen, wenn ich seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz habe.
Die Wiedereinbürgerung einer Person mit Wohnsitz in der Schweiz kostet CHF 900.-. Minderjährige, die selbständig ein Wiedereinbürgerungsgesuch stellen, zahlen CHF 650.-. Der gesamte Betrag ist im Voraus zu bezahlen und wird nicht zurückerstattet, wenn das Gesuch abgelehnt wird (Art. 25 BüV). Ratenzahlungen sind nicht möglich.
Die Wiedereinbürgerung einer Person mit Wohnsitz im Ausland kostet CHF 600.-. Minderjährige, die selbständig ein Wiedereinbürgerungsgesuch stellen, zahlen CHF 350.-. Der gesamte Betrag ist bei der zuständigen schweizerischen Vertretung in der entsprechenden Landeswährung im Voraus zu bezahlen. Die Gebühren werden nicht zurückerstattet, wenn das Gesuch abgelehnt wird (Art. 25 BüV). Ratenzahlungen sind nicht möglich.
Zudem erhebt die schweizerische Vertretung im Ausland für die erbrachten Dienstleistungen (Beratung, Entgegennahme der Dokumente, Interview, Studium der Akten, Bearbeitung der ausländischen Zivilstandsakten und Weiterleitung des Dossiers an das SEM sowie allfällige weiteren Abklärungen und Recherchen) zusätzlich ihre eigenen Gebühren nach ihrem effektiven Zeitaufwand. Im Weiteren können die Zivilstandsbehörden für ihre Tätigkeiten (Überprüfung ausländischer Dokumente im Hinblick auf die Aufnahme der Personenstandsdaten in Infostar) Gebühren separat in Rechnung stellen und via Schweizer Vertretung einkassieren lassen.
Letzte Änderung 23.05.2025